Die Stadt kaufte das Berckheim-Schloss

von Heinz Keller
Alle Beiträge in diesem Zeitungsarchiv sind erstmals in den Weinheimer Nachrichten erschienen. Die Veröffentlichung auf der Internetseite des Weinheimer Museums erfolgt mit der Zustimmung der DiesbachMedien GmbH.
„Als Bürgermeister der Stadt Weinheim habe ich, nach reiflicher Überlegung und nach Beratung mit den Beigeordneten und Ratsherren, gestern das gesamte Gräflich von Berckheim’sche Schloss und den Schlosspark zum Kaufpreis von 550.000 RM erworben”, berichtete Bürgermeister Dr. Reinhold Bezler, gänzlich unbescheiden, am 3. Dezember 1938 den Vertretern der örtlichen Presse, der Weinheimer Nachrichten und des Hakenkreuzbanner.
Am Ende eines der dunkelsten Jahre in der Stadtgeschichte mit der Zerstörung der Synagoge und dem gewaltsamen Ende der jüdischen Gemeinde Weinheim also doch noch ein Lichtblick: mit dem Schlosskauf erhielt Weinheim außergewöhnlich repräsentative Räume für seine Stadtverwaltung. Zwei Monate lang war zwischen dem Gräflichen Rentamt und der Stadtverwaltung über das Angebot von Dr. Philipp Graf von Berckheim verhandelt worden, den seit Ende 1925 von der Stadt für Teile ihrer Verwaltung angemieteten Nordflügel des Schlosskomplexes und zusätzlich den von der gräflichen Familie bewohnten Südflügel mit dem Schlosspark an die Stadt zu verkaufen.
Lange Verhandlungen
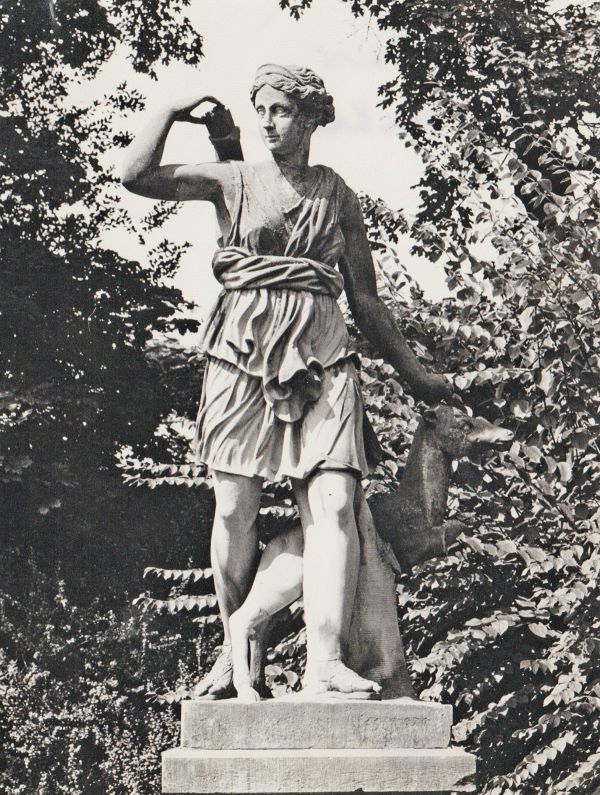
Die städtische Verhandlungskommission wurde zunächst von Oberbürgermeister Josef Huegel geleitet und nach seinem krankheitsbedingten Amtsverzicht ab 1. August von dem amtierenden Verwaltungschef, dem 1. Beigeordneten Dr. Friedrich Meiser. Erst in der Endphase war der am 3. November 1938 von Reichsstatthalter Robert Wagner zum neuen Bürgermeister ernannte Dr. Bezler an den Verhandlungen beteiligt. Der 33-Jährige war „Alter Kämpfer” der NSDAP, Träger des Goldenen Partei-abzeichens und bis dahin stellvertretender NS-Kreisleiter und Erster Beigeordneter in Pforzheim. Die Ernennung zum Amtsnachfolger von Huegel durch den badischen Gauleiter entsprach der am 1. April 1935 in Kraft getretenen „Deutschen Gemeindeordnung”. Mit ihr wurden Bürgermeister und Beigeordnete „durch das Vertrauen von Partei und Staat” in ihre Ämter berufen wie die nun Ratsherren genannten Gemeinderäte, die ebenfalls von Parteibeauftragten berufen wurden.
Zu Bezlers ersten Entscheidungen in Weinheim gehörte der Erlass der Nachtragshaushaltssatzung. Mit ihr wurde das Volumen des ordentlichen Haushalts von 3,16 auf 3,47 Millionen RM erhöht, der außerordentliche Haushalt wuchs von 222.373 RM auf 827.635 RM. Der Grund für die starke Ausweitung des außerordentlichen Etats war der Erwerb des Schlosses mit Schlosspark, der mit 583.000 RM (Kaufpreis plus 33.000 RM Grundbuch-kosten)etatisiert wurde. Exotenwald, Schloss-gärtnerei, Burg Windeck und Schlosskellerei blieben 1938 im Besitz der Grafen von Berckheim. Das Mausoleum wurde grundbuchmäßig vom Schlosspark abgetrennt und ist bis heute Familienbesitz. Das Gräflich von Berck-heim’sche Rentamt als Verwaltung des damals noch ausgedehnten gräflichen Grundbesitzes behielt seinen Sitz in Weinheim.
Am 30. April 1939 wurde der Schlosspark für die Bürger geöffnet, zu Pfingsten 1939 das Schlosscafé eingeweiht. 1955 erwarb das Land Baden-Württemberg den Exotenwald und erweiterte ihn auf seine heutige Größe von 60 Hektar, 1971 verkaufte der Graf den bis dahin als Rebgelände genutzten, 1,2 Hektar großen Schlossgarten an die Luppert Baugesellschaft aus dem südpfälzischen Hagenbach und es entstanden die sogenannten Luppert-Bauten, 1978 kaufte die Stadt Weinheim für 300.000 DM die Burgruine Windeck und führte umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durch.
Jahrhundertealte Geschichte

Das Weinheimer Schloss hat eine jahrhunderte-alte Geschichte. Schon im Mittelalter stand an der Nordwestecke der Stadtmauer, zwischen Obertor und Rotem Turm, ein Herrenhaus der Weinheimer Adelsfamilie Swende, die in der frühesten Stadtgeschichte eine wichtige Rolle spielte. Ludwig III., der 1410 die Kurwürde und mit der rheinischen Pfalzgrafschaft auch Weinheim erbte, kaufte 1423 den Swendehof. Auf dem höchsten Punkt der befestigten Stadt sollte, allerdings erst 100 Jahre später, ein pfalzgräfliches Schloss entstehen. Seine wesentlichen Gebäude stammen aus dem 16. Jahrhundert. Darauf weist die Jahreszahl 1537 am alten Treppenturm neben dem heutigen Aufgang zum Bürgersaal hin.
Die Pfalzgrafen nutzten ihr Weinheimer Schlösschen immer nur für kurze Zeit als Aufenthaltsort. Die Gebäude dienten im wesentlichen als Sitz der pfalzgräflichen Kellerei und zur Aufnahme der Zentabgaben. Das änderte sich 1698, als die Zerstörung des Heidelberger Schlosses die Verlegung des kurpfälzischen Hofes ins unzerstörte Weinheim notwendig machte. Kurfürst Johann Wilhelm und seine Gattin Anna Maria Luisa von Medici kamen am 19. August 1698 mit dem gesamten Regierungsapparat, einer großen Anzahl von Kavalieren und den Professoren der Heidelberger Universität, deren Druckerei ebenfalls hier untergebracht werden musste, in Weinheim an. Der Aufenthalt dauerte bis 1700. Das Fürstenpaar lebte allerdings in Düsseldorf und wohnte nur bei seinen Pfalzvisiten im Weinheimer Schloss.

1803 ging das kurfürstliche Schloss mit den Gebäuden um den heutigen Kleinen Schlosshof in den Besitz des neuen Großherzogtums Baden über. 1833 erwarb der damalige Weinheimer Bürgermeister Albert Ludwig Grimm diesen Schlossteil, 1853 verkaufte er ihn an seinen Nachbarn Christian Friedrich Freiherr von Berckheim, der bereits seit 1846 im Besitz des Adelshofs der Ulner von Dieburg auf der Südseite des Obertors war.
Der Adelshof der Ulner bestand schon im 16. Jahrhundert. 1725 ließ Franz Pleikart Ulner von Dieburg den Südflügel des heutigen Schlosses erbauen, 1788 wurde er klassizistisch umgebaut. 1837 verkaufte der Mannheimer Rechtsanwalt Dr. Friedrich Hecker, der spätere Anführer der badischen Revolution von 1848, im Auftrag des Ulner-Erben Karl von Venningen „das Schlossgebäude im Reichviertel am oberen Thor” an Gräfin Auguste Waldner von Freundstein, verwitwete Freifrau von Berckheim. Sie errichtete 1846 das Berckheimsche Stammgut, das „für alle Zeiten dem ehelichen Mannesstamm der Freiherrn von Berckheim” zufallen sollte.
Das Berckheimsche Schloss erhielt 1867/68 mit dem Abriss der Gebäude der einstigen pfalzgräflichen Kellerei und dem Bau des neuen Schlossturms, sowie 1893 mit den Umbauten zwischen Obertor und Turm sein heutiges Aussehen.
