Die Rettung der Kinder aus dem Lager Gurs
von Heinz Keller
Alle Beiträge in diesem Zeitungsarchiv sind erstmals in den Weinheimer Nachrichten erschienen. Die Veröffentlichung auf der Internetseite des Weinheimer Museums erfolgt mit der Zustimmung der DiesbachMedien GmbH.
Sie waren Kinder: Ernst Rapp war vier Jahre alt, Doris Hirsch sieben und Kurt Altstädter zehn Jahre, als am 22. Oktober 1940 Polizisten an ihrem Elternhaus in der Hauptstraße, der Müllheimer Talstraße und der Tannenstraße klingelten und die Familie aufforderten, sich in kürzester Zeit zum Abtransport fertig zu machen. Auf Lastwagen wurden die letzten Weinheimer Juden nach Mannheim gebracht, wo die Züge bereits warteten. Nach 72 Stunden quälender Fahrt erreichten sie die Station Olore/Ste.Marie im unbesetzten Frankreich und wurden auf Lastwagen ins 18 Kilometer entfernte Internierungslager Gurs gebracht. Hier fanden die völlig erschöpften Menschen in den feuchten Baracken nur Strohsäcke und Stroh auf dem Boden vor. Auf ihrem Gepäck – so sie solches hatten – verbrachten sie die erste Nacht im Camp de Gurs. Es war für die meisten der 6.500 badischen, pfälzischen und saarländischen Juden die letzte Station vor ihrer Vernichtung.
Die Rettung der Kinder
Mit der mörderischen, nach den NS-Gauleitern Robert Wagner und Josef Bürckel genannten „Wagner-Bürckel-Aktion” wurden 563 Kinder nach Gurs deportiert. 417 von ihnen konnten gerettet werden: versteckt in Bauernhöfen, in Klöster und Kinderheime in Frankreich oder in die Schweiz geschleust. Den meist dramatischen Rettungsaktionen und den mutigen französischen Rettern, die ihr Leben für die deutschen Kinder riskierten, hat das Pforzheimer Historiker-Ehepaar Brigitte und Gerhard Brändle eine 200-seitige Dokumentation gewidmet, die nicht als Buch erhältlich ist, aber auf der Webseite der Israelischen Religionsgemeinschaft (IRG) Baden heruntergeladen werden kann.
Unter dem Titel „Gerettete und ihre Retter – Jüdische Kinder im Lager Gurs: Fluchthilfe tut not - eine notwendige Erinnerung nach 80 Jahren” sind Kurzbiografien der Kinder und von 172 Rettern zusammengefasst. Die drei Weinheimer Kinder Ernst Rapp, Doris Hirsch und Kurt Altstädter sind dabei und zwei weitere Weinheimer Namen kann man unter den Pforzheimer Deportierten finden: Martin (11) und Lore Eckstein (19). Sie waren in Weinheim aufgewachsen und mit ihren Eltern 1939 nach Pforzheim umgezogen. Aus Hemsbach stammten Inge Ottenheimer (19) und Lotte Schlösser (13).
Ernst Rapp, Doris Hirsch, Kurt Altstädter und Martin Eckstein gehörten zu den aus Gurs geretteten Kindern, Lore Eckstein ist seit dem Abtransport „in den Osten“ verschollen, Lotte Schlösser starb in Auschwitz, Inge Ottenheimer konnte auf Umwegen in die USA ausreisen, weil ihre Mutter vor der Verhaftung die Visa beschafft und die Überfahrt bezahlt hatte. Kurt Altstädter und Martin Eckstein nahmen 1991 am Treffen ehemaliger jüdischer Weinheimer auf Einladung der Stadt teil.
Ein Müllemer Mädchen

Als „Mädchen mit der Puppe” ist Doris Hirsch in die Geschichte der jüdischen Gemeinde Weinheim und in die Dokumentationüber die aus Gurs geretteten Kinder eingegangen. Die Puppe der Marke Schildkröt begleitete die Siebenjährige nach Gurs und sie blieb im Lager, als sich Doris’ Mutter Martha Recha Hirsch (31) schweren Herzens entschloss, ihr Kind in die Obhut des franzosisch-jüdischen Kinderhilfswerks OSE (Oeuvre de Secours aux Enfants) zu geben, das sich in einer Grauzone von legalen und illegalen Aktivitäten bemühte, Kinder aus dem Internierungslager zu holen und sie in französischen Kinder- und Waisenheimen unterzubringen. Die Puppe blieb auch in Gurs, als alle Hirschs aus dem Weinheimer Müll ermordet wurden.
Für Doris Hirsch begann mit dem Verlassen des Lagers eine Odyssee: sie kam zunächst in ein Kinderheim des OSE in Montpellier, dann in einen Privathaushalt, wieder in ein Heim, diesmal in Grenoble, danach lebte sie unter lauter Frauen in einer Frauenklinik, wurde von einer Familie in Pau aufgenommen, arbeitete unter Nonnen in einem Bauernhof nahe Lourdes, schließlich wieder ein jüdisch-orthodoxes Kinderheim in Taverny – immer in Angst vor Entdeckung. Ein Onkel fand die nur noch französisch sprechende Nichte 1948 in Paris. Bei Verwandten in Frankfurt lernte Doris wieder deutsch. Mit einem US-Programm reiste die inzwischen Siebzehnjährige 1950 nach Amerika. In der kurzen Ehe mit dem Schweizer Franz Kappeler kam 1956 Tochter Linda zur Welt. 1989 besuchte Doris Hirsch-Kappeler ihre Geburtsstadt Weinheim, wurde dabei aber von schrecklichen Erinnerungen eingeholt und wollte deshalb 1991 nicht zum Heimattreffen ehemaliger jüdischer Mitbürger kommen.
Bub aus der Rumpelgass
In der „Vorstadt”, wie die Weinheimer das alte Großviertel zwischen Hauptstraße und Grundelbachstraße, Petersplatz und Dürreplatz nannten, lebten Christen und Juden einträchtig zusammen. Deshalb kam es auch nicht von ungefähr, dass die ersten Stolpersteine in der „Vorstadt“ verlegt wurden. In der einstigen Rumpelgass’, bei der Einmündung der heutigen Tannenstraße in die Kühgass, jetzt Lindenstraße, erinnern sie an Karolina und Ludwig Altstädter, die eine Mehl- und Getreidehandlung betrieben. Das Eiserne Kreuz 1. Klasse, das ihm für Mut und Tapferkeit im 1. Weltkrieg verliehen worden war, nützte Ludwig Altstädter am 22. Oktober 1940 nichts. Zusammen mit seiner Frau und dem zehnjährigen Sohn Kurt wurde er nach Gurs deportiert. Die Eltern starben 1942 in Auschwitz, der Junge war schon 1941 von OSE-Mitarbeitern aus dem Lager Gurs geholt und auf einem Bauernhof bei Aix-les-Bains versteckt worden. Im September 1943 wurde Kurt Altstädter zusammen mit zehn weiteren bedrohten jüdischen Kindern von Fluchthelfern des OSE über die Grenze nach Gy im Kanton Genf gebracht. In der Schweiz erlebte er das Kriegsende. Noch 1945 wanderte er zu Verwandten in Chile aus und baute in Santiago, der Hauptstadt, ein Eisenwaren-geschäft auf. Kurt Altstädter nahm 1991 am Heimattreffen teil, erinnerte sich an seine ersten Schuljahre in der Diesterwegschule und an einen „sehr strengen Lehrer“, aber nicht mehr an seinen Namen Friedrich Obländer.
Der Jüngste
Auch Ernst Rapp wurde vom OSE gerettet. Zwei Jahre nach dem Zwangsabschied aus dem stolzen Haus von Großvater Isaak Heil (heute Commerzbank) übergaben Tilli und Friedrich Rapp ihren im Lager lebensgefährlich erkrankten Sohn an das Kinderhilfswerk, das ihn im Schloss von Chabannes in Vichy zunächst in Sicherheit brachte. In dem alten Chateau wurden zwischen 1940 und 1945 etwa 400 jüdische Kinder vor dem Holocaust gerettet. 1942 konnten die Kinder noch rechtzeitig vor einer Razzia der Vichy-Polizei in französischen Familien unter-gebracht werden. Bei Kriegsende lebte der nur französisch sprechende Ernst Rapp in einem Heim für Kinder von Deportierten in Toulouse. Seine Schwester Margot, die 1939 noch mit einem Kindertransport nach Palästina ausreisen konnte, fand den inzwischen Dreizehnjährigen 19449 in Toulouse und nahm ihn mit nach Israel. Ernst Rapp studierte in Frankreich und lebte danach in Mexiko und Israel, seit 2008 in Freiburg. Seine Großmutter Recha Heil starb schon im ersten Lagerwinter, die Eltern Tilly und Friedrich Rapp wurden in Auschwitz ermordet. Seine Schwester Margot Seewi-Rapp starb 2012 in Köln.
Die Ecksteins
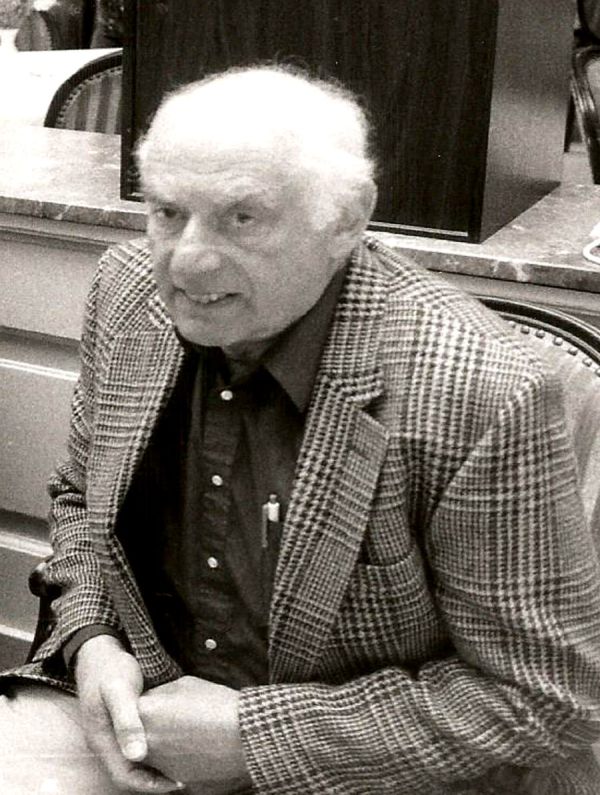
Martin Eckstein, damals elf, wurde am 22. Oktober 1940 zusammen mit Vater Albert (49), Mutter Felicitas (48) und Schwester Lore (19) nach Gurs deportiert – aus Pforzheim, wo sich die Familie sicherer wähnte als in Weinheim. In dem schmalen Haus an der Ecke Leiben-gässchen/Hauptstraße, nahe dem Rodensteiner-Brunnen betrieb Albert Eckstein eine Eisenwarenhandlung, Lore ging in die Pestalozzischule, Martin in die Diesterwegschule. Nach Vaters Haft im KZ Buchenwald scheiterten Fluchtpläne an der Finanzierung. Die Familie zog um nach Pforzheim und wurde hier von der Wagner-Bürckel-Aktion eingeholt. Die Eltern starben in Auschwitz, Lore wurde „in den Osten“ deportiert und ist verschollen. Martin wurde im Februar 1941 von Quäkern aus dem Lager Gurs in das Waisenheim „Maison des Pupilles” in Aspet am Fuß der Pyrenäen gebracht und 1943 an die Grenze zur Schweiz. In Zürich lebte Eckstein bei Verwandten und ließ sich zum Koch ausbilden. 1949 wanderte er nach Israel aus, 1955 in die USA. Die Briefe, die ihm Eltern und Schwester aus Gurs nach Aspet schrieben, gehören zu den bedrückendsten Dokumenten, die im Stadtarchiv Weinheim verwahrt werden, Martin Ecksteins Lebensbericht vor Schülern des Werner-Heisenberg-Gymnasiums brachte den schwerkranken Teilnehmer am Heimattreffen 1991 mit seiner Weinheimer Zeit ins Reine.
